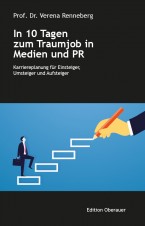Zürich - Überraschung in Zürich: "NZZ"-Chef Markus Spillmann ist heute überraschend zurückgetreten. In einem erstaunlich offenen Interview gab er dem "Schweizer Journalist" im Sommer 2013 Auskunft über die Probleme als "NZZ"-Chef.
Herr Spillmann, zunächst eine formale Frage: Bei einer Veranstaltung im vergangenen Herbst haben Sie gefordert, dass grössere Interviews nicht mehr autorisiert werden sollen. Sind Sie denn selbst bereit, auf die Autorisierung dieses Gesprächs zu verzichten?
Markus Spillmann: Ja. Das mache ich eigentlich immer so, wenn ich Interviews gebe. Wenn man es mir vorher schickt, ist es nett. Ich weise dann darauf hin, ob etwas stimmt oder nicht, aber ich halte nichts von Wortlautautorisierungen. Was gesagt ist, ist gesagt. Und wenn die andere Seite redlich arbeitet, sollte das gehen.
Jetzt bin ich überrascht. Sie sind nach Dutzenden von grossen Interviews im deutschsprachigen Raum der erste Journalist, der auf eine Autorisierung verzichtet.
Markus Spillmann: Schreiben Sie das so rein. Dann habe ich schon den ersten Schritt auf dem Weg zum Code of Conduct für die Schweizer Medienlandschaft gemacht, was Interviews betrifft.
Ich hätte gedacht, dass Sie den Verzicht auf das Gegenlesen zwar für andere wie Politiker und Wirtschaftsführer fordern, aber selbst lieber doch mal kurz drüberschauen wollen.
Markus Spillmann: Nein, ich bin ein konsequenter Mensch.
Gut, starten wir: Herr Spillmann, Sie sind jetzt mehr als sieben Jahre Chefredaktor der „NZZ“. Ein wichtige Aufgabe von Ihnen ist es, die Debatten des Landes zu prägen. Ich finde, dass Ihnen das bisher nur wenig gelungen ist.
Markus Spillmann: Es ist immer ein wenig schwierig, wenn jemand eine These in den Raum stellt, ohne sie zu begründen. Ich bin in allen grossen Themen präsent. Ich schreibe, vielleicht mit Ausnahme von Roger Köppel, am meisten als Chefredaktor in diesem Land.
Wir machen dazu gelegentlich Auswertungen im „Journalisten“. Ich kann Ihnen sagen: Andere schreiben mindestens so viel wie Sie.
Markus Spillmann: Es kommt darauf an, was Sie vergleichen. Ein Editorial ist etwas anderes als ein Leitartikel zu den gewichtigen Themen, die das Land prägen.
Aber eine vergleichbar prägende Stellung wie etwa der ehemalige Wirtschaftschef Gerhard Schwarz haben Sie nach meinem Eindruck noch nicht erreicht.
Markus Spillmann: Ich bin ja auch der Chefredaktor und nicht der Leiter Wirtschaft. Mischen Sie doch nicht unterschiedliche Aussagen zu einer These, das ist nicht seriös. Die „NZZ“ ist eine Spezialistenredaktion, als Chefredaktor sind Sie immer in der Generalistenrolle. Es kann ja sein, dass Sie der Einzige sind, der einen geraden Satz schreiben kann, wenn Sie eine Regionalzeitung führen, bei uns ist das leider nicht so. Die Kompetenz liegt in den Ressorts und das ist auch gut so. Es ist nicht der Spillmann, der die Debatte zu prägen hat, sondern die „NZZ“. Das ist für mich das, was zählt. Zudem gebe ich der Redaktion Guidelines bei kontroversen Themen.
Aus der Redaktion ist zu hören, Sie seien viel unterwegs und wenig präsent. Wie viele Wochen im Jahr machen Sie das Blatt?
Markus Spillmann: Das kann ich nicht sagen. Immer wenn ich da bin, bin ich Teil des Herstellungsprozesses.
Und wie oft ist das?
Markus Spillmann: Relativ oft.
Wie viele Wochen im Jahr?
Markus Spillmann: Keine Ahnung. Ich zähle doch meine Wochen nicht. Ich bin physisch viel präsent, ich reise relativ wenig.
Sitzen Sie noch am Balken und produzieren die Zeitung?
Markus Spillmann: Ja, wenn ich Tagesleitung habe.
Und wie oft ist das?
Markus Spillmann: Sooft ich das kann, mache ich das.
Das kann zwischen einer und 42 Wochen alles heissen.
Markus Spillmann: Das ist richtig.
Herr Spillmann, was stört Sie an den Fragen?
Markus Spillmann: Was mich ein bisschen stört, ist dieses Suggerieren bar jeder Einordnung in eine Gesamtüberlegung, was heute einen guten Chefredaktor ausmacht.
Das versuche ich gerade.
Markus Spillmann: Nein, Sie reduzieren das auf eine reine Quantitätsfrage, das ist heutzutage doch absurd. Ein Chefredaktor ist im Regelfall nicht mehr der Blattmacher. Normalerweise macht der Tagesleiter das operative Geschäft, sonst der Stellvertreter. Wenn beide ausfallen, mache ich es. Wir sind zu dritt. Aber wir machen hier ja nicht nur eine Zeitung. Ich bin in der Unternehmensleitung für die Gesamtpublizistik zuständig. Das geht logischerweise immer zulasten des operativen Geschäfts.
Gute Noten geben Ihnen viele intern in der Repräsentation nach aussen. Fühlen Sie sich da wohl?
Markus Spillmann: Was heisst wohlfühlen? Ich fühle mich nach innen und nach aussen wohl.
Es gibt in der Repräsentation nur einen Malus, der sich mit meiner Wahrnehmung deckt …
Markus Spillmann: (unterbricht) … wird das jetzt ein Qualifikationsgespräch, das Sie hier durchführen?
Ja.
Markus Spillmann: Das ist ja lustig.
Was missfällt Ihnen daran?
Markus Spillmann: Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen uninteressant. Mich würde als Leser mehr interessieren: Was macht denn die „NZZ“ jetzt, wie entwickelt sich die Welt in den nächsten Jahren und vor welchen Herausforderungen stehen wir? Ich versuche mich nicht so interessant zu machen. Ich halte auch nicht so wahnsinnig viel von Journalisten, die sich selbst so wichtig nehmen.
Wenn das so ist, warum moderieren Sie dann die „NZZ“-Standpunkte im Fernsehen? Das dient doch auch nur der Repräsentation.
Markus Spillmann: Weil die Sendung eine einfache Form der Markenprägung ist, die gut wirkt. Lustigerweise hat Fernsehen einfach einen höheren Impact.
Gab es auch die Option, das Format von einem Fernsehprofi moderieren zu lassen?
Markus Spillmann: Das Ziel der Sendung ist es, die Publizistik der „NZZ“ aufscheinen zu lassen. Das können Sie nicht delegieren.
Ich habe oft den Eindruck, dass die Eitelkeit über die Vernunft siegt, wenn Chefredaktoren im Fernsehen moderieren, die das Handwerk dafür nicht gelernt haben.
Markus Spillmann: Wenn das eine Kritik an mir ist, dann bitte ein bisschen konkreter. Wenn es eine generelle Kritik ist, trifft sie in meinem Fall nicht zu. Wir schulen uns regelmässig.
Gehen wir zurück zu Ihren Kernaufgaben: Die „NZZ“ hat im Oktober eine Bezahlschranke eingeführt. Die ganze Branche möchte wissen, wie die läuft.
Markus Spillmann: Die Paywall per se ist momentan sicher nicht der Reisser. Das wussten wir von Anfang an. Man muss aber sehen, dass die Paywall in eine Gesamtstrategie eingebunden ist und die heisst: Wir wollen für unsere Werte und Inhalte einen Preis.
Ihre Bezahlschranke greift erst nach 20 Klicks im Monat. Die sehr grosse Zahl der Gelegenheitsnutzer, die weniger als 20 Mal im Monat kommen, kann man nur schwer zu zahlenden Kunden machen. Welchen Sinn ergibt dann die Paywall?
Markus Spillmann: Aber umgekehrt: Was schadet sie denn? Die Stammklientel ist nicht von der Paywall betroffen. Ein Heavy User, der die NZZ nur browserbasiert liest, wird aber irgendwann genauso zur Kasse gebeten wie jemand, der ein Abo gekauft hat. Das ist die Logik der Argumentation. Wir sind jetzt konsistent in der Preispolitik. Ich hatte nie die Illusion, dass wir durch die Gelegenheitssurfer viele Erlöse erzielen können.
Aber mittelfristig soll das Modell ja mehr Erlöse bringen. Sie machen das jetzt seit einem Dreivierteljahr. Können Sie Zahlen nennen?
Markus Spillmann: Nein, da müssen Sie Peter Hogenkamp fragen, er ist für die Paywall verantwortlich. Es hat keinen Sinn, wenn ich Zahlen kommuniziere, weil ich momentan nicht so direkt in diesen Zahlensalat reingucken will. Für mich ist es wichtig, dass wir in der Logik konsistent sind, und das sind wir momentan.
Seit rund einem Jahr stellen Sie ja die Inhalte der Printausgabe ins Netz. Deshalb ist das Angebot für die Gratis-Gelegenheitsnutzer sogar noch besser als vorher.
Markus Spillmann: Gratis generiert Traffic und damit Werbeumsätze. Man muss immer aufpassen, die Paywallkonzeption nicht gegen das Reichweitenmodell auszuspielen. Letztlich geht es darum, möglichst umfassend das kommerzielle Potenzial abschöpfen zu können. Die Paywall wirkt nicht so, dass sie Kunden abhält. Klar ist unser Traffic eingebrochen im letzten Jahr, aber das hat verschiedene Gründe. Es wäre für mich als Publizist ja einfach zu sagen: das ist wegen der Paywall, aber das ist Quatsch.
Woran liegt der Rückgang der Reichweite im Netz?
Markus Spillmann: Wir haben das Design verändert und wir sind in der Markenführung von NZZ online weggegangen. Und – da kann man jetzt drüber streiten, ob es eine Ursache oder der Haupttreiber ist – die publizistische Leistung entspricht noch nicht einer onlineaffinen Kundschaft.
Gehen wir mal davon aus, dass Ihre Inhalte im deutschsprachigen Raum zu den besten gehören: Was heisst es, wenn diese Inhalte nicht so viel geklickt werden?
Markus Spillmann: In der Schweiz sind das Umfeld, in dem wir uns bewegen, 20 Minuten, Blick, Newsnet und inzwischen auch SRF. Blick und 20 Minuten arbeiten stark newsgetrieben und auch bildorientiert. Wir treffen also auf eine Kundschaft, die sich an einen gewissen Standard gewöhnt hat. Und jetzt kommen Sie mit dem ausgreifend, kompliziert geschriebenen Feuilleton-Artikel. Natürlich ist der klasse, aber er ist wahrscheinlich in dieser Konfiguration nicht eins zu eins für das Online-Angebot übertragbar, weil er für den Print geschrieben wurde. Wir haben daher im vergangenen Frühjahr begonnen, die Redaktion zusammenzulegen und gesagt: Dieser Prozess wird mindestens zwei Jahre dauern.
Im Interview mit dem deutschen „Kress-Report“ haben Sie gesagt: „Das Erstprodukt ist der digitale Kanal, und wir machen nebenbei auch noch eine hervorragende Zeitung.“ In Wahrheit ist es heute aber schon noch umgekehrt, oder?
Markus Spillmann: Wenn ich das auf einer Skala von 0 bis 100 abbilden müsste, würde ich sagen, sind wir heute bei 45 zu 55 zugunsten des Prints. Wir schieben diese Regler aneinander vorbei: In einem Jahr werden wir bei 70 zu 30 zugunsten des Digitalen sein.
Jahrelang hat die „NZZ“ gar nichts gemacht und plötzlich preschen Sie vor.
Markus Spillmann: Moment, ich bin seit 2006 im Amt und seitdem sind wir in einem Veränderungsprozess.
Okay, aber zwischen 2006 und 2009 ist wenig passiert.
Markus Spillmann: Nein, das stimmt so nicht. Sie müssen ja in einen Organismus hineinblicken: Was musste alles gemacht werden, um überhaupt Speed zu gewinnen? Wir haben in dieser Zeit ein Newsroomkonzept umgesetzt, wir haben eine Tagesleitung eingeführt. Das war alles Tabu in der „NZZ“. Jetzt können Sie mich messen mit dem „Tages-Anzeiger“ oder wem auch immer. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin 2006 hier reingekommen und habe eine Organisation angetroffen, die so war wie in den letzten 50 Jahren. Das ist auch völlig okay, ich werte das gar nicht.
Das machen Sie natürlich schon gerade.
Markus Spillmann: Nein. Aber Sie brauchen Zeit, um sich neu aufzustellen. Sie müssen Konzepte erarbeiten für einen solchen Changeprozess. Es nützt ja nichts, so etwas zu initiieren, und dann bleiben Sie nach zwei Monaten ausser Atem stehen und sagen: Scheisse, wir haben uns leider verspekuliert.
Sie haben begonnen, im Mai und Juni 2012 Inhalte der Zeitung ins Online zu überführen. Die Paywall ist im Oktober gestartet. Dazwischen hätte der Traffic eigentlich deutlich ansteigen müssen. Schliesslich waren die Perlen des „NZZ“-Angebots jetzt verfügbar. Die Zugriffe sind aber gesunken. Kann es sein, dass Ihre Inhalte zu schwerfällig sind?
Markus Spillmann: Die Umstellung 2012 war die erste Stufe. Dass da noch nicht alles onlinegerecht ist, ist ja logisch. Print ist nicht Online, Print hat eine andere Aufmachung und Taktung. Das hat auch viel mit dem Tempo zu tun. Deshalb haben wir im Januar die Nachrichtenredaktion nochmals umgebaut und begonnen, das Nachrichtliche stärker zu betonen. Wir haben Ressorts verstärkt, wo der Traffic erlahmt ist. Das sind alles kleine Schritte. Und wenn ich jetzt die neuesten Zahlen anschaue, ist es uns mindestens gelungen, die Negativentwicklung zu korrigieren.
Kann es sein, dass die hochgelobten Print-Inhalte gar nicht so nachgefragt sind?
Markus Spillmann: Lustigerweise stimmt das gar nicht, wenn wir unsere Messinstrumente anschauen. Es ist nicht so, dass der Artikel über Kate bei uns überdurchschnittlich mehr geklickt wird als zum Beispiel ein Beitrag über Bücher aus Timbuktu. Warum? Weil unser Klientel affin ist für die Geschichte über Bücher aus Timbuktu.
Bei der Zeitung wissen Sie das aber gar nicht.
Markus Spillmann: Wir sind ja immer noch erfolgreich mit dem Printprodukt. Sonst wären wir ja schon lange zugrunde gegangen. Sind wir aber nicht. Unsere Leser tätigen eine ganz bewusste Kaufentscheidung.
Aber sie tätigen sie immer weniger.
Markus Spillmann: Ja, aber das ist ein genereller Trend. Das liegt nicht per se am Inhalt. Ich kenne keinen Zeitungsmarkt in der westlichen Hemisphäre, der nicht die gleichen Tendenzen zeigt. Es sind einfach keine wachsenden Märkte.
Die „NZZ“ hatte bei Ihrem Start vor sieben Jahren 125.800 verkaufte Abos. Jetzt sind es noch 105.600. Verglichen mit den anderen Regionalzeitungen in der Schweiz ist das ordentlich. In Deutschland allerdings haben die Qualitätsmarken „Süddeutsche“ und „FAZ“ deutlich weniger eingebüsst. Warum?
Markus Spillmann: Soweit ich weiss, hat die „Süddeutsche“ vor allem regional gewonnen und bei den Kollegen in Frankfurt mag das mit den Schwächen der „Welt“ zusammenhängen. Ich vergleiche uns mit dem Benchmark Schweiz und da performt die „NZZ“ nicht ganz so schlecht wie andere.
Wenn man unter Journalisten fragt, halten viele die „NZZ“ für zuverlässig und seriös, aber auch für langweilig. Warum muss Seriosität so langweilig sein?
Markus Spillmann: Was erwarten Sie jetzt vom Chefredaktor der „Neuen Zürcher Zeitung“? Dass er auf eine Community-Aussage reagiert und sagt: Wir sind nicht langweilig? Entschuldigung, die Frage ist albern. Mich interessiert der Markterfolg.
Könnte es für die „NZZ“ dennoch ein Weg sein, das Lesevergnügen mehr in den Vordergrund zu stellen? Ein Leser sagte mir: „Die ,NZZ‘ ist für mich ein Arbeitsinstrument, aber es macht keinen Spass, sie zu lesen.“
Markus Spillmann: Die Frage ist immer, wovon reden Sie. Es gibt einzelne Artikel, die sind staubtrocken, es gibt andere, die sind super. Es ist doch die Kombination aus Verschiedenem, die eine gute Publizistik ausmacht.
Könnten Sie sich mehr narrative Elemente vorstellen? Die „FAZ“ und die „SZ“ beispielsweise haben mehr Reportagen und variieren die Stilformen insgesamt mehr.
Markus Spillmann: Es ist sicher so, dass wir nicht ausgeprägt reportagig sind. Das Narrative gehört nicht zu unseren Kernstärken, vor allem nicht in gewissen Ressorts. Es gibt aber immer wieder bei uns auch Themenumsetzungen, wie Sie sie sonst nicht finden. Ich bin sehr viel in Deutschland und Österreich unterwegs. Ich staune jedes Mal, wie die „NZZ“ dort von Lesern hoch geschätzt wird.
Könnten Sie sich vorstellen, ein Konzept in den nächsten ein, zwei Jahren umzusetzen, bei dem Sie in den Mittelpunkt stellen, narrativer, humorvoller und frecher zu werden?
Markus Spillmann: Es geht nicht um ein Konzept für ein, zwei Jahre. Dahinter steht diese Vorstellung: Drück auf einen Knopf und es passiert was. Es ist aber ein Prozess und der läuft seit sieben Jahren. Narrative Elemente stärker zu bedienen, femininer werden – wobei das heikel ist: Was heisst das denn genau? –, das sind Themen, die wir laufend diskutieren. Wir verändern uns zum Teil sehr schnell.
Wo genau?
Markus Spillmann: Wo wir uns dramatisch verändert haben, ist in unserer internen Diskussionskultur, wie wir heute Themen anpacken. Wir sind heute ausserdem schneller geworden. Und wir haben die Konvergenz umgesetzt: Wir sind heute eine Redaktion, ohne dass die Entwicklung abgeschlossen ist.
Sie haben ja gesagt, es geht um den Markterfolg. Welche Veränderung sieht der Nutzer?
Markus Spillmann: Die Zeitung ist eine andere als vor drei, vier Jahren. Online ist etwas anderes als vor einem Dreivierteljahr. Sie unterstellen Stillstand …
… nein, ich unterstelle sehr langsame Veränderung.
Markus Spillmann: Es ist ja nicht an mir, das zu falsifizieren. Aber das finde ich schon lächerlich. Also, wenn man der „NZZ“ heute noch Langsamkeit unterstellt, muss ich sagen: Hallo! Dann hat man einiges nicht mitbekommen. Wir sind es bei vielem, die voranstürmen.
Ich beziehe mich aufs Produkt.
Markus Spillmann: Wo sehen Sie denn momentan ein besonders innovatives Produkt?
In der Schweiz hat sich der „Tages-Anzeiger“ sicher mehr verändert als die „NZZ“.
Markus Spillmann: Ja, deutlich ausgedünnt vor allem: Wirtschaft findet praktisch nicht mehr statt, Kultur ist heute eher eventorientiert. Wo sich der „Tages-Anzeiger“ stark verändert hat, ist im ersten Bund. Dort versucht er, jeden Tag so etwas wie ein Tages-Magazin zu machen, kippt aber logischerweise auch immer wieder zurück, wenn beispielsweise in der Innenpolitik viel passiert.
Ihr neuer VR-Chef Jornod hat kürzlich gesagt, Journalisten müssten auch unternehmerischer denken. Das bedeutet: Es geht auch darum, Geschichten besser zu verkaufen. Müssen Sie da Ihre Kultur ändern?
Markus Spillmann: Autorenmarketing machen wir stärker denn je, weil ich überzeugt davon bin, dass Autoren auf die Marke NZZ ausstrahlen und umgekehrt.
Könnten Sie sich auch vorstellen, Artikel mehr zu verkaufen und mehr zuzuspitzen?
Markus Spillmann: Aber jetzt müssen Sie mir, Herr Wiegand, doch mal erklären, was Sie eigentlich für ein publizistisches Bild vor Augen haben. Für welche Art von Journalismus stehen Sie ein? Ich habe eine Null-Fehlertoleranz. Wenn ich heute sehe, was in diesem Land teilweise publizistisch getan wird, dann muss ich sagen: Das mag ja zuspitzend sein und Schlagzeilen und Klicks produzieren, aber das ist nicht die Haltung der „NZZ“. Das ist eine Kulturfrage.
Stört es Sie eigentlich, dass Sie als Chefredaktor ganz schön auf den Deckel bekommen?
Markus Spillmann: Den Eindruck habe ich nicht. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ist aber nicht so gemeint: Ich habe lernen müssen, das Unqualifizierte vom Qualifizierten zu unterscheiden. Unqualifizierte Kritik interessiert mich nicht mehr, qualifizierte Kritik nehme ich sehr ernst.
Was war denn so eine qualifizierte Kritik?
Markus Spillmann: Viele Kollegen, die mich wohlwollend begleiten, haben mir gesagt: Mach bei Personalentscheidungen schnell reinen Tisch. Das habe ich anfangs nicht gemacht.
Die „NZZ“ wird insgesamt sehr streng bewertet.
Markus Spillmann: Das war schon immer so. Die „NZZ“ ist für viele Berufskollegen eben immer noch erste Adresse. Ich muss zwischendurch schon schmunzeln, wenn ich sehe, wer sich bei uns bewirbt und wer über uns schreibt. Die „NZZ“ ist immer noch eine Referenz. Und das ist auch gut so. Wir sind immer noch so was wie eine Reibungsfläche. Vielleicht fällt es auch deshalb leicht, an uns immer wieder rumzupicken, weil wir selbst an uns so hohe Ansprüche stellen und ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, das andere auch irritiert.
Kann man das irritierende Selbstbewusstsein nicht auch mal runterschrauben?
Markus Spillmann: Warum sollten wir?
Weil es vielleicht sympathischer wirkt, auch auf die Leser.
Markus Spillmann: Mein Gott: Sympathie, Antipathie. Das, was Sie schildern, ist so eine Branchensicht. Was ich sehe, ist das Gegenteil. Wenn ich unterwegs bin, erlebe ich eine manchmal fast schon peinliche Wertschätzung.
Welches Fazit ziehen Sie selbst zu Ihrer Amtszeit?
Markus Spillmann: Wir haben enorme Schritte durchgezogen: Wir haben die Zeitung reformiert und werden sie weiter reformieren. Wir sind publizistischer geworden, wir setzen eine sehr aggressive Digitalisierungsstrategie um. Ausserdem bemisst sich Leistung auch immer ein bisschen nach der Umgebungstemperatur. Ich war in der dramatischen Medienkrise 2008 und 2009 im Gegensatz zu vielen Kollegen schon im Amt. Innerhalb von Wochen musste man dramatische Entscheidungen fällen und Leute entlassen. Das machen Sie nicht einfach mit einem Lächeln auf den Lippen.Da kämpfen Sie und versuchen Kurs zu halten. Und ich habe es überlebt und wir haben kein Blutbad angerichtet, sondern die Probleme mit Anstand gelöst.
Wie sehen Sie unabhängig von der „NZZ“ die Zukunft des Journalismus?
Markus Spillmann: Ich glaube, wir laufen in eine Zeit, in der der Endkonsument relativ stark Einfluss nehmen wird auf die Art der Darbietung dessen, was wir leisten. Ich glaube, dass künftig nicht mehr der „One size fits all“-Gedanke dominieren wird. Der Endkonsument erwartet künftig sehr stark kraft der Markenaffinität eine Kuration von Journalisten oder er will selber aus Inhalten kuratieren. Das zu bauen und zu betreiben, wird die grosse Herausforderung. Inwieweit dabei ein klassisch strukturiertes Printprodukt wie eine Tageszeitung eine Rolle spielt, will ich mal offenlassen.
Was heisst das für die Zeitung?
Markus Spillmann: Das bedeutet, dass sie zwar künftig die „NZZ“ konsumieren, die aber nichts mehr mit einer klassischen Zeitung oder einem webbasierten Online-Auftritt zu tun hat. Sie konsumieren über Social Media, über Newsletter oder über ein individuell zu kuratierendes Angebot, bei dem sie beispielsweise nur spezifisch einen Autor zu einem Thema lesen werden. Und dafür sind sie bereit, etwas zu bezahlen. Wir müssen fähig sein, ihnen das zu bieten. Und das können wir heute nicht, weder technologisch noch redaktionell.
Von welchen Zeiträumen gehen Sie für die digitale Transformation aus?
Markus Spillmann: Wir sehen jetzt schon deutliche Veränderungen im Nutzungsverhalten. Ich gehe davon aus, dass das Tempo zunehmen wird.
Dürfen wir zum Schluss noch mal persönlich werden?
Markus Spillmann: Noch persönlicher?
Sie sind in nur zehn Jahren vom Redaktor zu dem Prestigejob im Schweizer Journalismus aufgestiegen. Sie waren da gerade 38 Jahre alt. Wie geht es einem da?
Markus Spillmann: Mein Gott, wie geht es einem da?
Alles, was sie sagten, hatte plötzlich Bedeutung für die Marke „NZZ“.
Markus Spillmann: Ja, klar. Sie sind Repräsentant der Marke. Deshalb müssen Sie vielleicht auch ein bisschen mehr aufpassen, wie Sie sich geben. Aber ich mache es ganz kurz: Ich bin jetzt seit sieben Jahren hier und ich lebe immer noch und es macht mir Spass. Ich beschäftige mich in dieser Hinsicht nicht so wahnsinnig viel mit mir selbst.
War das Amt Ihnen nie eine Last?
Markus Spillmann: Wenn Sie fragen: Haben Sie schlaflose Nächte? Ja, natürlich habe ich die.
Ernsthaft?
Markus Spillmann: Natürlich. Ich bewundere Manager, die sagen: an mir geht das völlig vorbei. An mir geht es nicht vorbei. Das liegt auch daran, dass in der Medienwelt ähnlich wie im Fussball immer alle mitreden können. Und Sie sind in einer Branche tätig, die gerne austeilt und ungern einsteckt. Das ist nicht immer einfach. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde: Das perlt alles an mir ab. Ich bin heute stark durch die Erfahrung von 2008 und 2009 geprägt. Da musste ich als relativ junger Chefredaktor zum ersten Mal in der Geschichte deutliche Schnitte auf personeller Ebene durchführen. Wenn Sie altgediente Kollegen in Frühruhestand schicken müssen, wenn auch sozial verträglich abgefedert, dann geht das nicht spurlos an Ihnen vorbei.
Üblicherweise erwartet man von Führungskräften, dass sie Härte zeigen.
Markus Spillmann: Deswegen haben wir so viele Burnouts und Herzinfarkte. Genau deswegen.
Was machen Sie privat, um Abstand zu bekommen?
Markus Spillmann: Was privat ist, bleibt auch privat. Ich mache mich nicht zur öffentlichen Person.
Können Sie überhaupt noch Privatmensch sein? Gehen Sie zum Beispiel in Freizeitsachen zum Bäcker?
Markus Spillmann: Ja, dazu gibt es eine Anekdote. Ich bin mal an einem Samstag früh in Goldbach in diesem Baumarkt gewesen in T-Shirt und Jeans und begegne dort Martin Kall. Der schaut mich von oben bis unten an und sagt: „Schön, dass es dich auch in dieser Version gibt.“ Als Privatmensch benehme ich mich auch so. Ich lasse allerdings auch da nicht die Sau raus, ganz einfach weil mir das nicht liegt.
Das Interview mit Markus Spillmann führte Markus Wiegand, Chefredaktor vom "Schweizer Journalist". Es erschien zuerst in der Sommerausgabe 2013 vom "Schweizer Journalist".
Zur Person: Markus Spillmann wurde 1967 in Basel geboren und studierte an den Universitäten in Basel und Zürich Politische Wissenschaften, Geschichte und Volkswirtschaftslehre. Sein Studium schloss er mit einer Arbeit über komplexe Interdependenzen im internationalen System ab. Spillmann stieg 1995 bei der „Neuen Zürcher Zeitung“ ein, zunächst als Dienstredaktor, dann als Auslandredaktor mit Fokus auf Sicherheitspolitik/Terrorismus, Völkerrecht sowie die Länder Südasiens und Grossbritannien. Ab Sommer 2001 arbeitete er bei der Lancierung der „NZZ am Sonntag“ mit. Dort war er zwischen 2002 und 2005 als Ressortleiter International und Stellvertreter des Chefredaktors tätig. Seit April 2006 ist er Chefredaktor der „Neuen Zürcher Zeitung“ und Leiter Publizistik NZZ.